Du solltest diese Geschichte bis zum Schluß lesen. Ernsthaft. Denn gegen Ende kommt, wie in manchen Filmen, ein „Twist“. Da findest du heraus: Das Opfer ist in Wahrheit der Täter, die Leiche lebt noch und der Juwelenraub hat in dieser Form nicht stattgefunden, wie Du es die längste Zeit dachtest. Also dann: Kassel.

Ich kam 1998 zum Musikstudium. Klassische Gitarre und Klavier. Davor hatte ich viele Jahre in Bands gespielt und diverse House- und Techno-Party besucht. Aber als ich nach Kassel kam hatte ich kurze Haare, trug die meiste Zeit Anzughemden und dachte ernsthaft, ich würde mein Studium als Gitarrist verlassen. Im Studium lernte ich Musik kennen, die ich durchaus interessant fand: Scarlatti, Mendelsohn, Corelli und irgendwann auch Bach. Allerdings wurden alle Student*innen dazu verdonnert, im Chor zu singen. Lobpreisungen auf Gott aus meinem Mund oder im Tenor die Matthäus-Passion? Das ging mir entschieden zu weit. Musiktheorie, Musikgeschichte, Instrumentenkunde: Da konnte ich was lernen. Und gleichzeitig stolperte ich in Kassel in eine völlig andere Welt: Elektronische Musik. Ich lernte DJs und Produzenten kennen und spielte bald in einigen Bars und Clubs: Stammheim, A.R.M. und Lolita Bar. Das diese Clubs und Musiker zur Speerspitze der elektronischen Musik in Deutschland gehörten, war mir weder klar noch wichtig. Mich interessierte es vor allem, neue Musik kennenzulernen, neue Hard- und Software zu benutzen und Live-Konzerte zu spielen, die ganz anders waren, als ich es mit meinen Bands zuvor erlebt hatte. Es wurde viel experimentiert und improvisiert. Was nur gut funktioniert, wenn man sich gut kennt und weiß, wo der andere gerade hin will. Wenn das gelingt, entsteht darüber natürlich auch eine vertrauensvolle Beziehung zu den Mitmusikern. Das Publikum in Kassel zu dieser Zeit war fantastisch: Es war offen und neugierig und man konnte daher ständig Neues ausprobieren.
Und während ich tagsüber lernte, wie Beethoven in seinen verschiedenen Phasen Klaviersonaten strukturierte, wie man grundtonverkürzte Sept-Nonen-Akkorde auflösen kann und welche Übungen die Präzision in meinem Ringfinger bei schwierigen Akkorden verbessern können – lernte ich nachts viel über die Kraft von Repetitionen, ADSR-Kurven und Sägezahn-Wellen. Es gefiel mir gut, in diesem Spagat zu leben: Einerseits individuell-angefertigte Konzert-Gitarren für viele tausend Mark zu spielen, andererseits am Abend die E-Gitarre für den Club auszuwählen, die eine Jägermeister-Dusche am besten wegstecken würde.
Was es für mich besonders spannend machte: Diese beiden Welten überschnitten sich in keiner Weise. Ich traf tagsüber beim Studium keine Leute, die ich am Abend zuvor im Club gesehen hatte und auch musikalisch hatten diese Welten nichts miteinander zu tun. Schon früh kam mir der Begriff „Ausgleichssport“ in den Sinn, nur wußte ich eigentlich nie, was meine Hauptbeschäftigung war und welche Welt dem Ausgleich diente. Und ich erkannte schnell, dass mir beides zusammen gut tat: Lernte ich tagsüber gewisse Regeln, welche Tonleitern gewissen Kompositionen zu Grunde liegen, musste ich am Abend lernen: Es sind die „falschen“ Töne, die moderne Musik richtig klingen lassen. Konkret: Über einem a-Moll-Akkord penetrant die Note „C#“ zu spielen ist deutlich mehr „Techno“ als die, eigentlich naheliegende, Note „c“ zu spielen. Bei Tag „Kontrapunkt“ und „Generalbass“, bei Nacht „Vocoder“ und „Step Sequencer“. Aber ich will hier nicht zu weit in die technischen und musiktheoretischen Details gehen.
Die grobe Richtung dürfte klar geworden sein: Während meiner Jahre in Kassel hatte ich eigentlich zwei Musikausbildungen. Die eine bei Tag. Die andere bei Nacht. Und auch wenn ich zu dieser Zeit starke Zweifel hatte, ob sich dieser Spagat nicht als großer Fehler herausstellen würde (anstatt sich mit Haut und Haaren für einen Weg zu entscheiden…) – so habe ich diese Jahre vollständig in dieser Ambivalenz gelebt. Viele Jahre später, natürlich, wird sich dieser Weg als clever herausstellen. Heute profitiere ich von beidem gleichermaßen. Privat und beruflich. Aber zu dieser Zeit war das keine bewußte Strategie – es hatte sich einfach so ergeben. Und ich hätte es mir nie vorstellen können, dass sich diese so unterschiedlichen Fäden einmal verknoten lassen zu etwas sinnvollem. Wie es ja schließlich gekommen ist. Aber das konnte ich ja nicht wissen, damals in Kassel.
Aus diesem Stoff könnte man einen sehr aalglatten, romantischen Hollywood-Film mit Happy-End machen. Wenn man die folgenden Facetten rausläßt und unterschlägt: Das Musikstudium hatte nichts mit Kreativität zu tun. Dabei liebe ich es ja vor allem, mir neue Songs und Tracks auszudenken. Kreativität ist aber ein Motor, der am Laufen gehalten werden will. Noch einen Tag länger in der Musikakademie – und mein kreativer Motor hätte einen irreparablen Kolbenfresser davongetragen. Es war wirklich knapp! Es ging nur um bereits geschriebene Musik, die oft viele hundert Jahre alt war. Nichts neues war erwünscht oder gefordert. Schnell kam ich mir vor wie ein Zirkusaffe, dem bewährte Kunststücke beigebracht werden sollten. Man benötigt Kreativität, um der geschriebenen Partitur einer Symphonie als Dirigent den eigenen Stempel aufzudrücken. Nur war ich leider nicht Dirigent. Sondern klassische Gitarre und Klavier. Um ein eigenes Stück bei der Abschlussprüfung spielen zu können, mußte ich einen unbekannten, klassischen Komponisten erfinden und ihn als Autor angeben. „Johannes Käfig“ – ein Wortspiel mit dem Namen „John Cage“, den es ja tatsächlich gab.
Und meine Kommiliton*innen waren von einer speziellen Sorte: In der Mehrheit feine Töchter von Zahnärztinnen und Architekten. Das verrückteste, was sie je im Leben angestellt haben, war eine Tempoangabe in einem Ravel-Stück zu missachten und es 2 BPM schneller als gefordert zu spielen. Kleine Übertreibung. Seit ihrer Kindheit hatten sie jeden Tag viel Zeit am Instrument verbracht – und wenig mit anderen Kindern gespielt, würde ich mal behaupten. Das Soziale und Zwischenmenschliche war oft etwas unterentwickelt. Mit Ausnahme der Studierenden aus den östlichen Bundesländern. Und den vielen Koreanern dort, mit denen ich mit recht gut verstand. Aber das war die deutliche Minderheit dort. Sich mit den „klassischen“ Musikstudent*innen umgeben zu müssen, fühlte sich für mich an, wie mit Migrationshintergrund auf einem AFD-Parteitag zu sitzen. Als Werder-Fan im HSV-Block. Mit einem Neon-Outfit auf einem „The Cure“-Konzert. Gesprächsthemen oder Interessen jenseits der klassischen Musik? Meistens Fehlanzeige. Ab dem 4. Semester habe ich regelmäßig so getan, als würde ich telefonieren, um beim Betreten des Gebäudes oder bei Raumwechseln meinen Kommiliton*innen aus dem Weg zu gehen. Krass, oder? Obwohl wir 4 Jahre lang jede Woche Unterricht zusammen hatten, hat mich mein Gitarren-Professor nicht ein einziges Mal gefragt, wie es mir geht. Moderne Musik? Strawinsky. Von den Beatles hatte er schon gehört. Aber das ist ja keine richtige „Musik“.
Aber auf der anderen Seite auch nicht besser: Im Club (gemessen!) 117 dB. Schon 125 dB wären ein Düsenjet, mit den Ohren direkt an den Turbinen. Noch einen Gig mehr – und ich wäre jetzt taub. Und das ist nun keine Übertreibung. Und die Menschen um mich herum mit Drogenproblemen wie aus „Trainspotting“. Mit allen sozialen Defiziten ausgestattet, die Drogenkonsum mit sich bringt. Lügen, Betrug, Unzuverlässigkeit, Selbstüberschätzung. Das Publikum in den Bars und Clubs war ab einer gewissen Uhrzeit zu 99% von Substanzen bestimmt. Die Musiker und DJs natürlich auch. Dabei hatte ich zu ihnen, anders als zu meinen Kommiliton*innen, einen viel persönlicheren Draht. Daher war die Enttäuschung über dieses und jenes hier auch um einiges größer. Und wenn man einmal morgens um 11 Uhr einen Techno-Club bei Tageslicht gesehen hat, ist jegliche Romantik sowieso dahin. Und, wenn ich ehrlich zu mir und Euch bin, habe ich bei Nacht gelegentlich auch die Kontrolle über mich verloren und einige Male eine gruselige Figur abgegeben. Leider kann ich mich heute noch an alles erinnern. Einiges davon würde ich gerne ungeschehen machen. Nicht nur musikalisch. Denn es war die Zeit der MiniDisc-Recorder und damit ließen sich die Konzerte digital mitschneiden. Was ich da später hören konnte, war kilometerweit von der Erinnerung entfernt, die ich von manchen Abenden im Kopf gespeichert hatte. Oder eher: Lichtjahre. Immerhin habe ich für mich daraus die Lehren gezogen – und eigentlich nichts davon hat sich seitdem in diesem Maß (oder sollte ich besser sagen: Maßlosigkeit…) wiederholt. Wilder kann es im „Studio 54“ in den späten 70ern eigentlich auch nicht zugegangen sein. Und nicht jede Sequenz in Reportagen und Dokus über das „Studio 54“ ist ausnahmslos appetitlich.
Was man in einem aalglatten Film also als zwei Welten darstellen könnte, die sich gegenseitig befruchten, könnte man das auch genauso gut als zwei Höllen verfilmen, in denen man gefangen ist. Das wäre der Film, bei dem David Lynch Regie führt. Nicht unterschlagen sollte ich, dass ich in beiden Welten jeweils einen „Freund fürs Leben“ gefunden habe, mit denen ich bis zum heutigen Tag jede Sorge besprechen kann.
Und ich werde jetzt keine „abschließende Betrachtung“ schreiben, um mit einem pädagogischen Hintergedanken diese Geschichte vielleicht mit Ratschlägen für angehende Musiker*innen abzuschließen. So war es zu dieser Zeit bei mir. Es hatte sich nun mal so so ergeben.
Dürfte ich mir aussuchen, wer diese Episode aus meinem Leben verfilmen sollte, dann würde ich William Shakespeare wählen. Denn er hat ohne jeden Zweifel verstanden, wie nah Komödie und Tragödie manchmal liegen können und wie schnell sich erhabene Momente mit Banalitäten und Abgründen vermischen können. Leider wird sich dieser Wunsch niemals umsetzen lassen – genau so wenig, wie herauszufinden, was wohl gewesen wäre, wenn ich nur in der einen oder anderen Welt gelebt hätte…


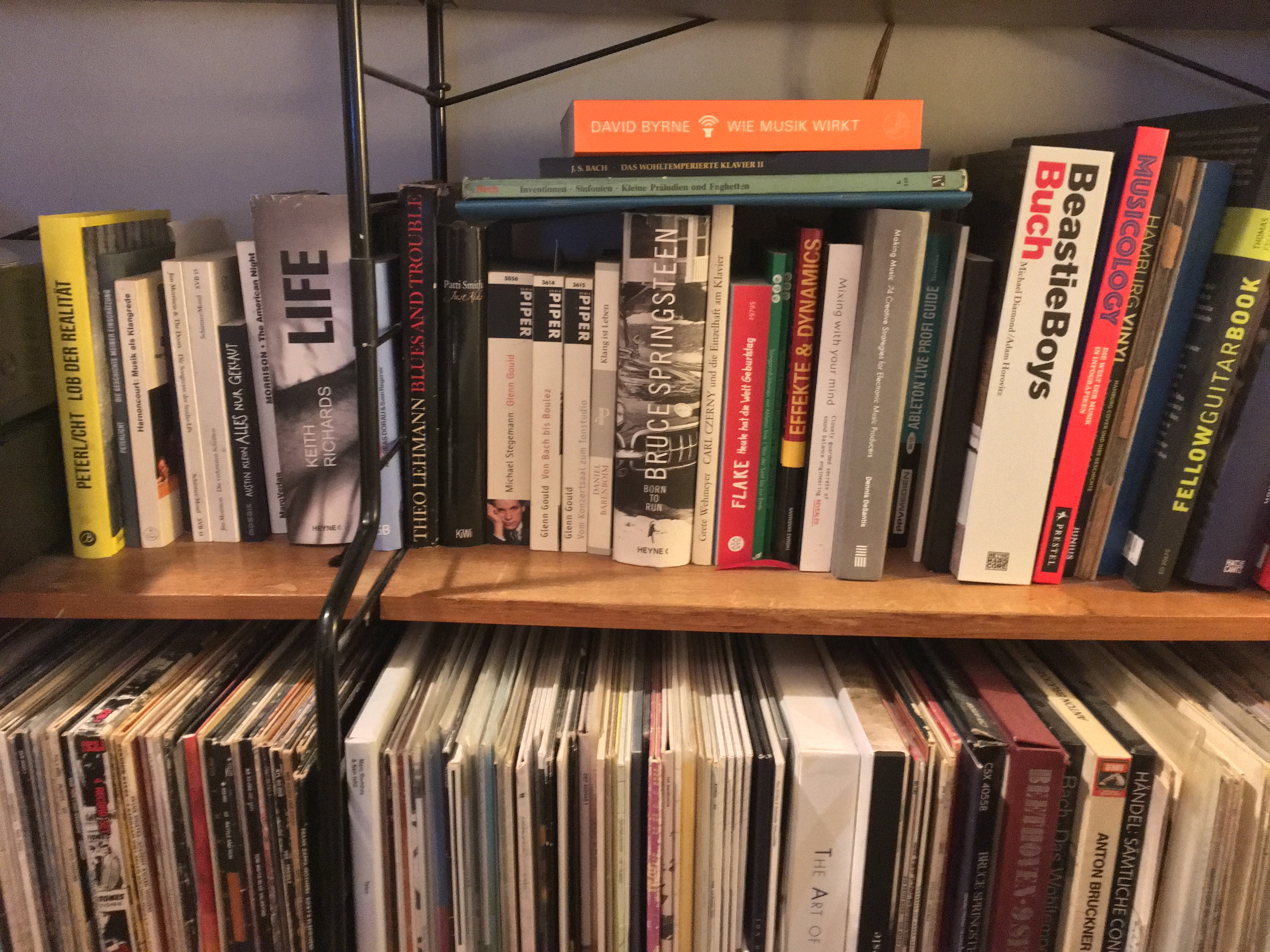
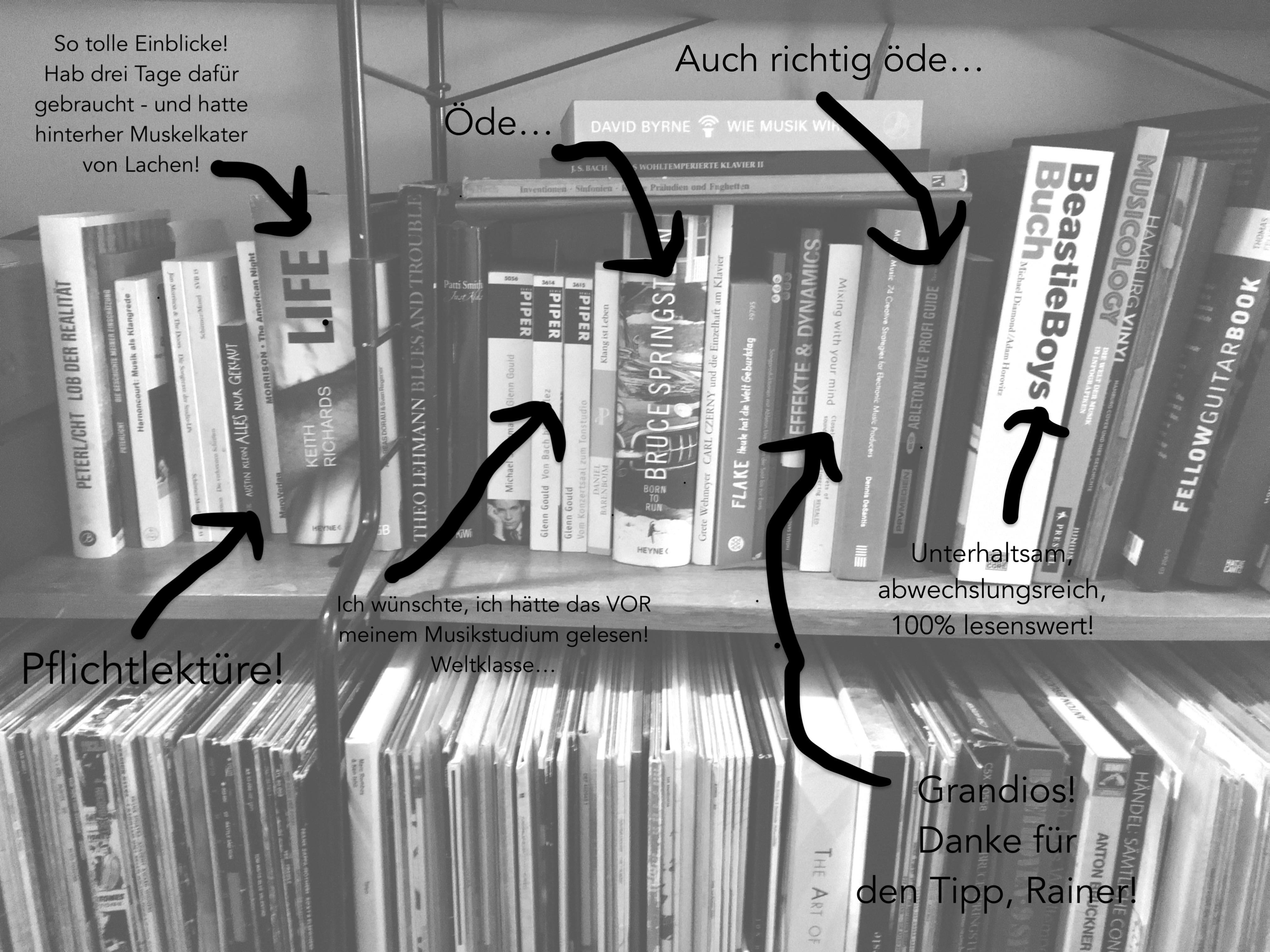
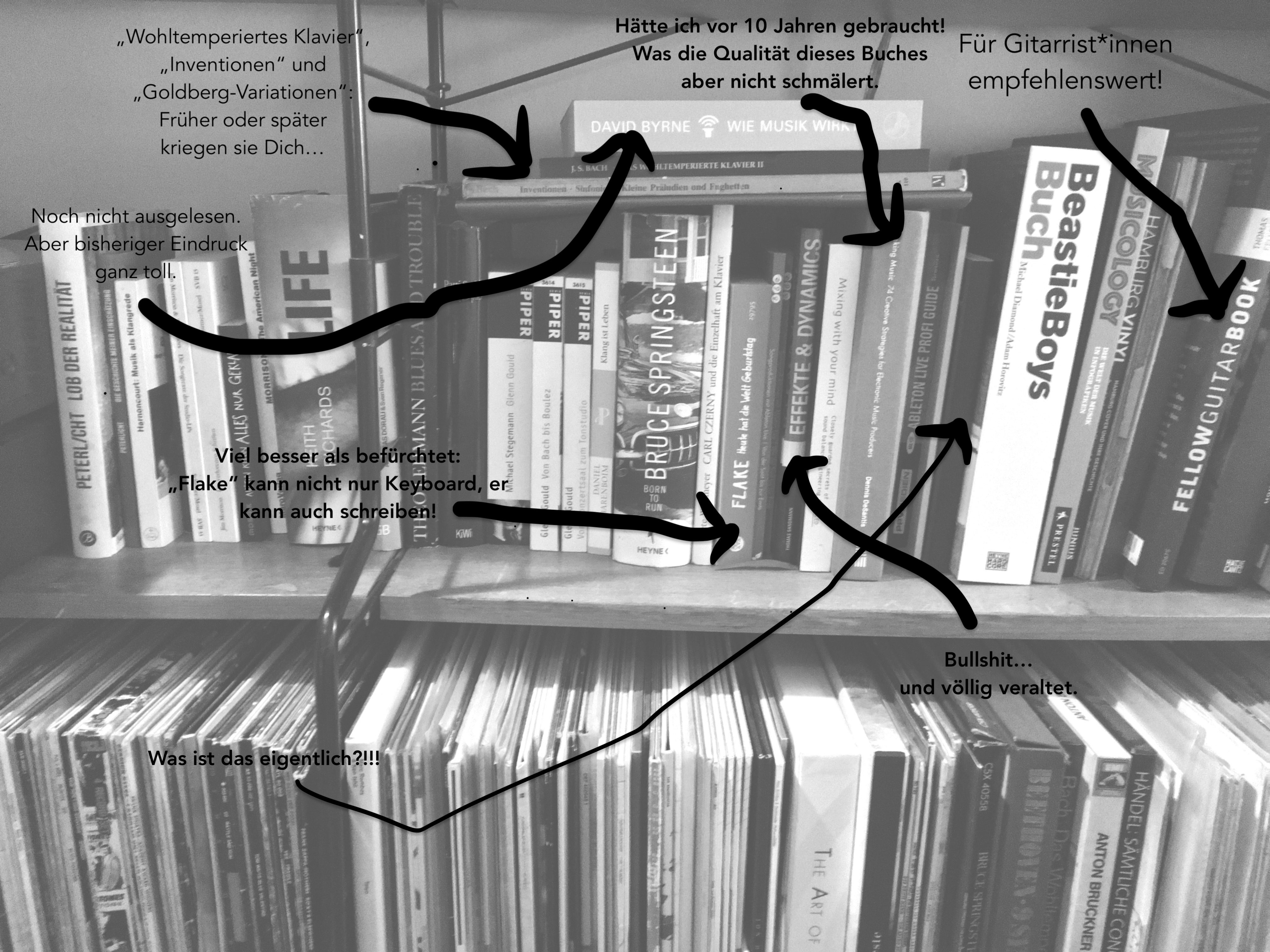
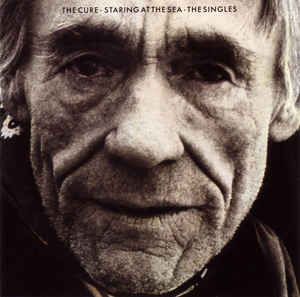
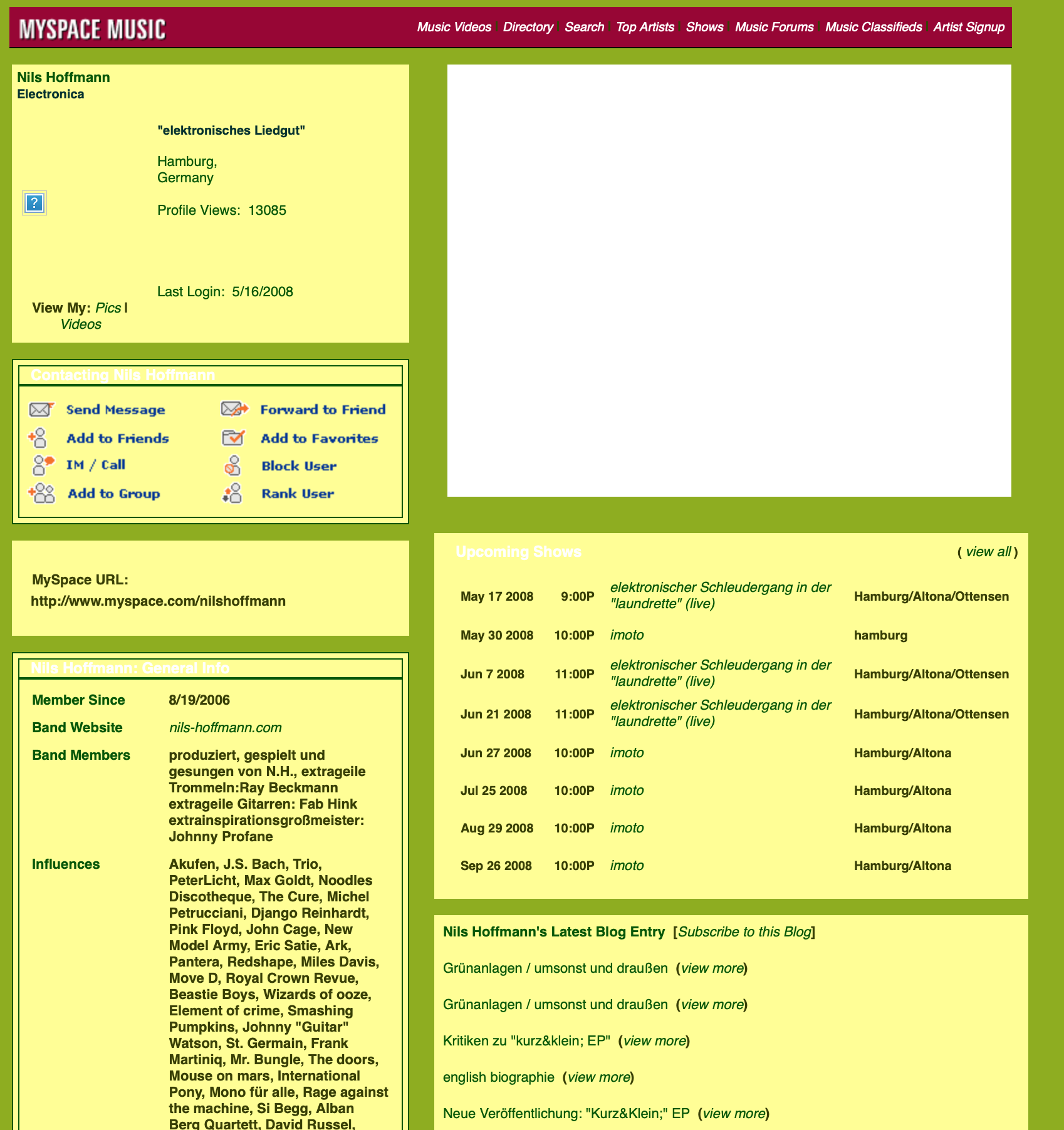
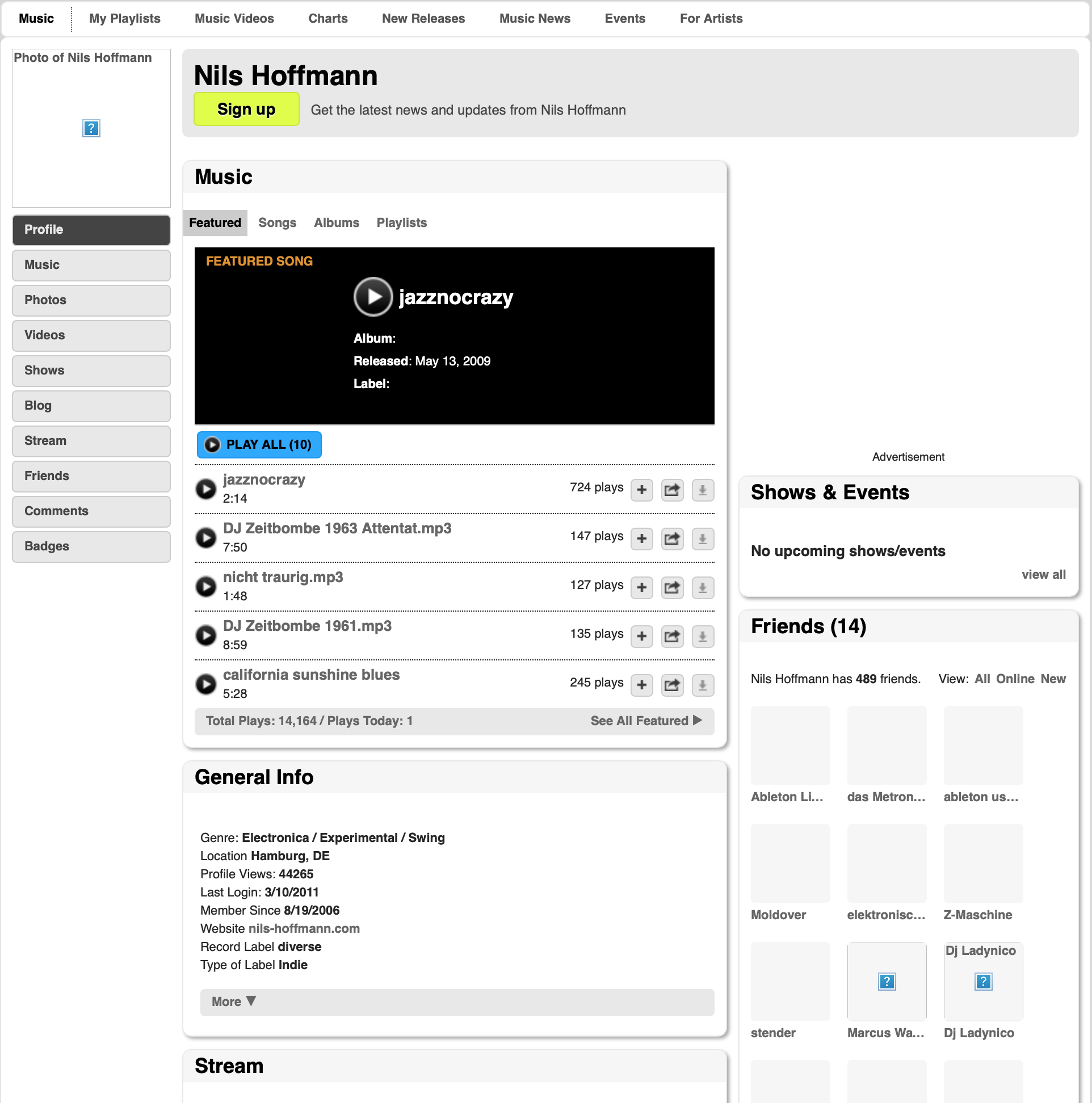 (ca. 2011)
(ca. 2011)
